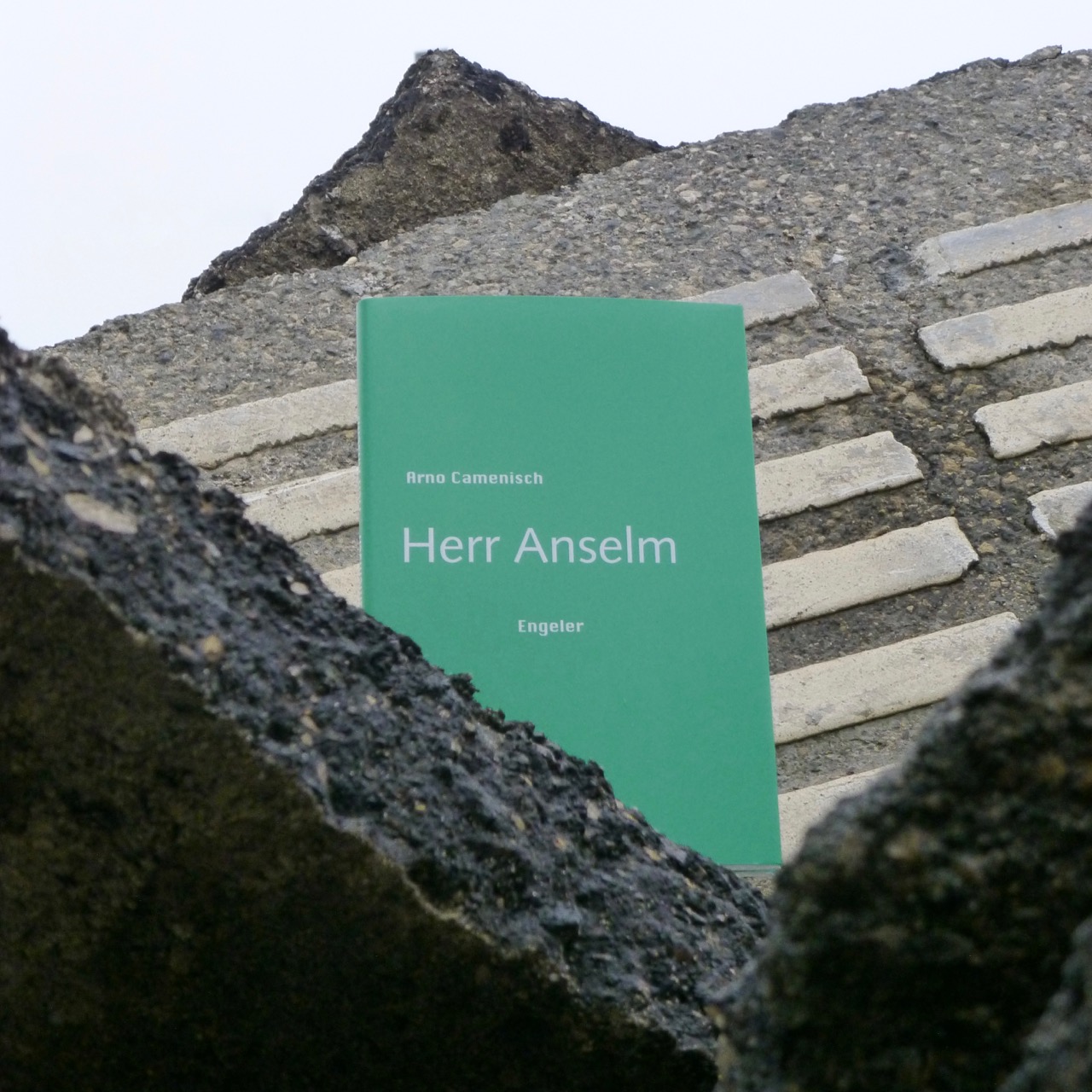In dem kleinen Dorf, irgendwo in den Bündner Bergen, war früher alles irgendwie ein bisschen besser. Nun soll auch die Schule geschlossen werden, «das Flaggschiff im Dorf». In seinem neuen Buch erzählt Arno Camenisch mit gewohntem Sprachwitz über Vergangenes und Vergehendes – eine Rezension von Elias Stark
Herr Anselm hat «nicht farruct gute Nachrichten», als er ans Grab seiner verstorbenen Frau kommt. Er bringt Blumen, gelbe Astern, neun Stück an der Zahl. Die Schule soll geschlossen werden und Herr Anselm, seines Zeichens seit dreiunddreissig Jahren Abwart, soll mit ihr untergehen wie der Kapitän mit seinem Schiff.
Aber sie werden sich wehren, sagt er, und während er sich über den «Gmaindspräsident» ärgert, erinnert sich Herr Anselm daran, was er in seiner Zeit als Abwart erleben durfte. Episodenhaft kommen sie daher, die kleinen Erzählungen des alltäglichen Lebens, die Arno Camenisch in seinem neuen Roman Herr Anselm der titelgebenden Hauptfigur in den Mund legt – von der Znünipause auf dem Schulhausdach bis zum Pingpongspiel auf dem Pausenplatz («Ein bisschen Pingpong hat noch immer geholfen»).
Von Vergessen und Erinnern
Man merkt Herrn Anselm an, wie viel die Schule ihm bedeutet. So wie er die Konstante im Schulbetrieb ist, so ist die Schule die Konstante in seinem Leben. Er ist das Gedächtnis der Schule, notiert die Namen der Schüler auf Klassenfotos, «damit nicht vergessen geht, wer alles hier war». Und sowieso, «solange der Fotograf, die gute Seele, uns auf dem Radar hat, sind wir nicht verloren». Camenischs Buch ist ein Plädoyer gegen das Vergessen, denn «mit der Schule stirbt auch die Erinnerung».
Vergessen und Erinnern sind in Camenischs Werken nichts Neues. Der 41-jährige Bündner wurde in seiner Heimat Zeuge des Aussterbens von kleinen Dörfern, vom Leben im Dorf. So verwundert es nicht, dass sich auch Herr Anselm gegen das Vergessen sträubt. Schliesslich ist der ganze Roman eine einzige, grosse Erinnerung, wobei die kleinen Erinnerungen gerahmt sind vom vielleicht wichtigsten Akt der Erinnerung– dem Besuch am Grab einer Verstorbenen.
Weil Camenisch Herrn Anselm zu einer Person sprechen lässt, die keine Antwort geben kann, fühlt es sich so an, als würden sich die Gedanken direkt an den Leser richten. Nur wenn Herr Anselm zwischendurch seine Liebste als «mia Cara» anspricht, wird einem bewusst, dass man nicht selbst Teil der Geschichte ist. Das für Camenisch typische Gemisch aus Bündnerdeutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und wohl noch einigen Sprachen mehr, zieht den Leser in seinen Bann. Es sind Worte, wie sie aus dem Kopf des belesenen und welterfahrenen Bündner Abwarts stammen könnten. Daran ändern auch die langen Sätze nichts, die Camenisch mit ausdrucksstarken Bildern füllt («wie tausend Gedanken waren die Sterne dort oben am Firmament»).
Eine Schule fürs Leben
Die Geschichten des Abwarts ergänzt Camenisch mit Lebensweisheiten, die meistens erhellend und mit amüsanten Beispielen versehen sind, hin und wieder aber auch abgedroschen und klischeehaft wirken («Man muss nämlich nicht immer alles wissen»). Herr Anselms Schule dient nicht nur dazu, Wissen anzuhäufen. Sie vermittelt Werte fürs Leben. Das Warten, zum Beispiel, «müssen die Kinder nämlich auch lernen, wo das Leben doch hauptsächlich darin besteht, dass wir warten». Diese Werte drohen mit der Schule verloren zu gehen, vergessen zu werden. In Herr Anselms Klagen, schwingt auch immer eine leichte Gegenwartskritik mit, wenn «es bereits ganze Städte auf der Welt gibt, die Wasser sparen müssen», «vom Russisch dänä bis rüber nach Pjöngjang geschrien und gelogen wird» oder die Leute «wie eingefroren mit dem Kopf im Bildschirm» an der Strasse stehen.
Camenisch schafft es, auf nur hundert Seiten eine Geschichte von Vergessen und Erinnern zu erzählen, die zum Denken anregt. Sein neuer Roman ist kein Buch, das man eben schnell in einem Schwung liest. Damit tut man sich keinen Gefallen und wird dem Roman nicht gerecht. Wenn Camenisch Herrn Anselm über den Zustand der Welt sinnieren lässt, dann ist das immer auch eine Einladung an den Leser, einen Moment inne zu halten, seine eigenen Gedanken zu ordnen und die Welt nicht einfach so hinzunehmen, wie sie zu sein scheint. «Und was morgen ist, werden wir sehen.»
Arno Camenisch: Herr Anselm. Engeler Verlag. 100 Seiten.