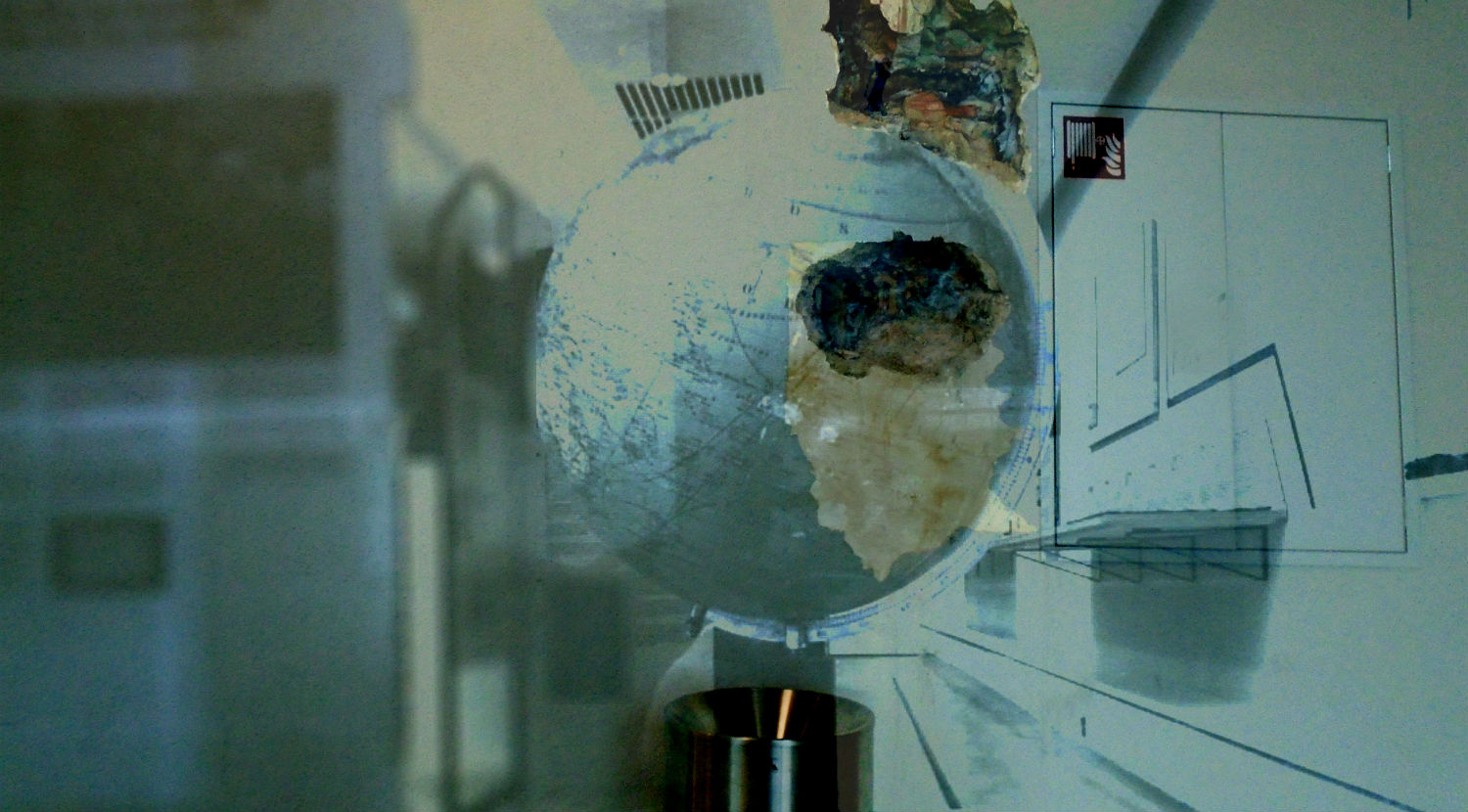Populismus, Fake News, Umweltzerstörung und Krieg dominieren die Nachrichten. Alles scheint verloren. Doch es gibt einen Ausweg: die Literatur. Die folgenden Autorinnen und Autoren setzen sich in ihren Büchern kritisch mit der Gegenwart auseinander und zeigen, was wir besser machen können
Ein Junkie gegen das System
von Bettina Wittwer
Wenn das eigene Leben einem Albtraum gleicht; wenn man seinen Platz in der Gesellschaft nicht finden kann; wenn es nichts mehr gibt, das einem etwas bedeutet, dann meldet man sich eben bei der Army. In Nico Walkers Debütroman «Cherry» nimmt der junge, namenlose Protagonist den Leser mit auf seine Lebensreise aus einer Identitätskrise in den traumatisierenden Krieg im Irak und wieder zurück in die Drogenszene Nordamerikas. Die Handlung ist knapp – und dennoch passiert unglaublich viel. Die stark autobiografisch inspirierte Geschichte berührt, bewegt, ekelt, erschreckt mich und bringt mich sogar zum Schmunzeln.
Sie ist das genaue Gegenteil einer Heldengeschichte: Der Protagonist versinkt in einer Gesellschaft, die für ihn keinen Platz hat, sinkt in die Verzweiflung, die Drogen und schliesslich die Kriminalität ab.
Für wen eignet sich das Buch?
Walkers Roman braucht einen starken Magen, denn der selbst inhaftierte Autor nimmt kein Blatt vor den Mund: Seine Gesellschaftskritik kommt in rauer, gefühlloser Form und der sprachlichen Direktheit eines Ex-Junkies daher – und holt mich genau deshalb im Sturm ab. Wer eine frische Perspektive auf die feine Trennlinie zwischen Glücklichsein und Trostlosigkeit gewinnen möchte, für die Leute ist «Cherry» genau das Richtige.
Potenzial, die Welt zu verändern?
Vor allem die kritische Auseinandersetzung mit dem Militär und unserer rücksichtslosen Gesellschaft bietet viel Denkfutter. Walkers Erzählung ist erfrischend ehrlich und hinterlässt genau deshalb einen bleibenden Eindruck.
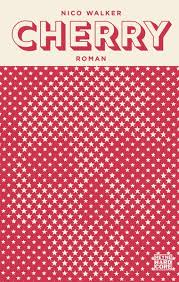
Walker, Nico: «Cherry»,
aus dem amerikanischen Englisch von Daniel Müller, Heyne, 379 Seiten
Ein Erwachen in der Stillen Nacht
von Lara Kammermann
Der junge Priester Fairfax blickt auf den entstellten Leichnam seines Kollegen. «Ein wahrhaft ungewöhnlicher Sturz», bemerkt er. Doch eigentlich soll Fairfax nur dessen Beerdigung abhalten, Skepsis ist unerwünscht. Im Bücherregel des Toten stösst er auf ketzerische Bücher, die bei Leuten, die diese besitzen, oft ein Brandmal -«H für Häresie»- auf der Stirn hinterlassen. Sie widersprechen den Lehren der Kirche, die das postapokalyptische England 800 Jahre nach unserer heutigen Zeit in mittelalterlicher Manier beherrschen. Deren Version lautet wie folgt: Gott bestrafte die Menschheit mit der Apokalypse. Schuld war ihr Glaube an die Wissenschaft – ihre neue, dem Allmächtigen gegenüber aber machtlose Gottheit. Bald kommen in Fairfax Zweifel auf. Stimmt das wirklich?
Für wen eignet sich das Buch?
Lesen: Egal ob stilecht im flackernden Kerzenschein oder als E-Book auf einem dieser rechteckigen Geräte «aus Plastik und Glas». Das Buch ist spannend, es liest sich flüssig und es entführt uns in eine fremde Welt aus Dunkelheit. Für alle, die eintauchen wollen in die raue Realität von mittelalterlichem Glauben.
Potenzial, die Welt zu verändern?
Klimawandel, Atomkrieg, nur zwei der Szenarien, die unsere «moderne, wissenschaftsbasierte Lebensweise» bedrohen könnten. Doch Harris eigentliche Warnung bezieht sich auf das, was folgt. Ein Ausfall der Technologie führt zu allgemeiner Hilflosigkeit. Wir verlassen uns zu sehr auf die kleinen Geräte mit dem Gefahrensymbol des angebissenen Apfel auf der Rückseite. Der Wunsch nach Erkenntnis endet mit einer Vertreibung aus dem Paradies, lehrt uns die Bibel. Wie machen wir weiter, wenn die Bildschirme unserer Handys tot sind, wir aber (noch) nicht?

Robert Harris: «Der zweite Schlaf»,
aus dem Englischen von Wolfgang Müller, Heyne, 416 Seiten
Von Pferden und Menschen
von Elias Stark
Maja Lundes neues Buch handelt von den letzten Wildpferden. Gewohnt spannend und mit vielen Emotionen überbrückt die Schwedin die Grenzen der Zeit und erzählt drei berührende Geschichten von Menschen, deren Schicksale eng verbunden sind mit jenem ihrer Tiere.
Das Buch beginnt 1881 in St. Petersburg. Der Zoologe Michail macht sich mit dem Tierfänger Wilhelm Wolff auf eine beschwerliche Reise quer durch den asiatischen Kontinent. In der Mongolei wollen sie die letzten echten Wildpferde fangen, um sie im zoologischen Garten auszustellen. Dabei kommt Michail an seine körperlichen und seelischen Grenzen und findet in Wilhelm mehr als einfach nur einen Freund. Unbeabsichtigt bringt er einen Stein ins Rollen, der das Schicksal einer ganzen Art besiegelt.
100 Jahre später, 1991, fliegt die Tierärztin Karin an den Ort, an dem Michail einst seine ersten Wildpferde einfing. Mit dabei hat sie sieben Pferde: Sie sollen in ihrer alten Heimat angesiedelt werden, wo sie vor über fünfzig Jahren ausstarben. Während Karin sich fürsorglich um die Tiere kümmert, ringt sie mit den Gefühlen gegenüber ihrem inzwischen erwachsenen Sohn Matthias. Oft hat er sie schon enttäuscht und doch fühlt sie sich für ihn verantwortlich. Zumindest scheint es ihm und den Pferden in der Mongolei gut zu gehen. Doch dann kommt der Winter und Karin muss schwere Entscheidungen treffen, die nicht nur ihr eigenes Leben verändern werden.
2064. Der Klimakollaps ist eingetreten. Europa zerfällt. Auf der Flucht vor Hitze, Dürre und Hunger wandern die Menschen nordwärts. Eva und ihre Tochter Isa jedoch bleiben auf ihrem Hof. Denn Eva hat hier eine Aufgabe: Sie muss die letzten beiden Wildpferde beschützen – die Letzten ihrer Art. Bis eines Tages eine junge Frau auftaucht, die alles verändert.
Für wen eignet sich das Buch?
Maja Lunde zieht den Leser sofort in ihren Bann. Aber Vorsicht: Aus ein paar Seiten können schnell mehrere hundert werden.
Potenzial, die Welt zu verändern:
Die Welt verändern wird Maja Lundes neues Buch zwar nicht, aber ein Blick ins Buch lohnt sich allemal. Und auch wenn Lundes dystopische Zukunftsvision manchmal übertrieben pessimistisch wirkt, spricht die Schwedin auch unbequeme Themen an.
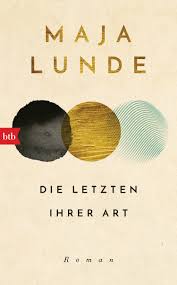
Maja Lunde: «Die Letzten ihrer Art»
aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein, btb, 637 Seiten
Alle Macht den Insekten
von Tobias Brunner
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Grossbritannien von einer Kakerlake regiert wird. Klingt verrückt, oder? Laut dem britischen Autor Ian McEwan und seinem Roman «Die Kakerlake» ist die Realität 2019 gar nicht so anders.
In Anlehnung an Franz Kafka erwacht die titelgebende Kakerlake aus unruhigen Träumen und findet sich im Körper von Premierminister Jim Sams wieder. Die Hintergründe bleiben unklar, nicht aber ihr Auftrag: den Volkswillen durchsetzen, mit allen Mitteln.
McEwans ganz eigener «Brexit» ist die Umkehrung des Währungsflusses: Beim «Kaufen» von Produkten bekommt man Geld, welches man wieder loswerden muss, indem man für Arbeit «bezahlen» darf. Auch das klingt verrückt, verdeutlicht aber den Wahnsinn, den viele Briten im Brexit sehen.
Aufgescheucht durch den rechten politischen Rand (und wenige Linke) wird ein solches Referendum angenommen. Sams bekommt zudem Unterstützung durch den fernsehsüchtigen, twitternden US-Präsidenten Archie Tupper. Man kennt es. Dazu die ein oder andere Intrige, noch einmal kräftig umrühren und die Politsatire ist servierbereit.
Für wen eignet sich das Buch?
Alle, die von politischen Diskussionen eine Auszeit brauchen. Auf 130 Seiten liefert McEwan eine Brexit-Satire, die trotz der bitterbösen Politiker-Kakerlaken-Gleichsetzung gut verdaulich bleibt. Bisweilen etwas harmlos, doch als Gegenprogramm zu lauten, vulgären Politikern wie Boris Johnson oder Donald Trump ganz erholsam.
Potenzial, die Welt zu verändern?
Kritisches Denken wird auch in Zukunft nicht weniger wichtig. «Die Kakerlake» hilft dabei. Auch wenn McEwan zum Teil mehr mit dem Holzhammer als der spitzen Feder agiert, zeigt das Buch gut verständlich auf, wie Populismus funktioniert.
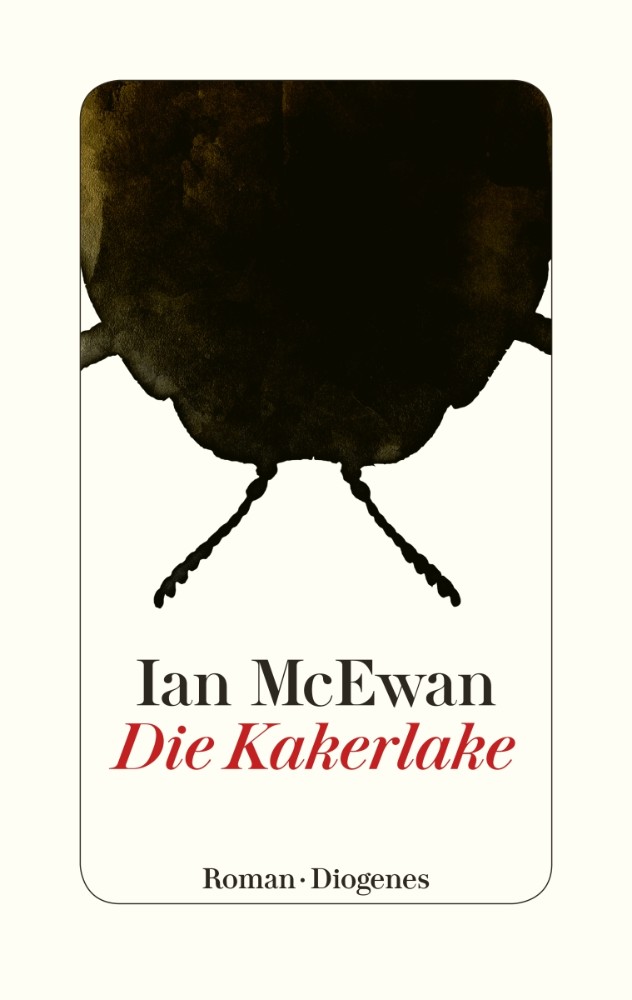
Ian McEwan: «Die Kakerlake»
aus dem Englischen von Bernhard Robben, Diogenes, 144 Seiten
Gefälschte Wahrheiten
von Philipp Stolz
«You’re Fake News!», schimpft Donald Trump, den Zeigefinger anklagend ausgestreckt. Der Präsident der Vereinigten Staaten und die Fake News – ein unzertrennliches Paar. Und die Beschuldigten? Werfen die Anschuldigung prompt zurück. Wer lügt also? Trump? Die Medien? Alle? Keiner?
Das neuste Büchlein des Literaturwissenschaftlers Thomas Strässle hilft, diese Fragen zu klären. «Fake und Fiktion» heisst es und sein Name ist Programm: Der Autor öffnet seinen Werkzeugkoffer und schraubt erfundene Wahrheiten auseinander. Zum Vorschein kommen die feinen Zahnräder der Täuschungsmaschine. Strässle zeigt, wie diese aufgebaut ist, wie ihre Komponenten zusammenspielen und wie sich der Fake von der Fiktion unterscheidet.
In Einzelteilen vorliegend ist eine gefälschte Information harmlos. Das Zusammensetzen jedoch bringt ein Monster hervor: Der Fake kennt keine Moral. Der Fake macht abhängig und unselbständig. Der Fake ist antidemokratisch. Und der Fake ist überall: Wie eine Epidemie verbreitet er sich, insbesondere in den sozialen Medien.
Arglose Bürgerinnen und Bürger müssen auf der Hut sein, denn in der digitalen Domäne droht die Ansteckung. Thomas Strässles «Fake und Fiktion» kommt einem Impfstoff gleich: Der Konsum führt zur Bildung von Antikörpern, die schädlichen Erregern keine Chance lassen.
Für wen?
Strässles Essay ist für alle, die ihre demokratischen Rechte hochhalten. Sein Anliegen ist ein politisches, stammt aber nicht aus einer bestimmten Ecke: Die vorgestellten Werkzeuge dienen allen im selben Mass als Vergrösserungsglas, mit dem genauer hingeschaut werden kann.
Potenzial, die Welt zu verändern
Eine Gesellschaft muss in der Lage sein, Fakt, Fake und Fiktion auseinanderzuhalten, um fruchtbare Diskussionen führen zu können: Nichts Geringeres als die Demokratie steht auf dem Spiel. Mit Strässles «Fake und Fiktion» haben wir ein Ass im Ärmel.
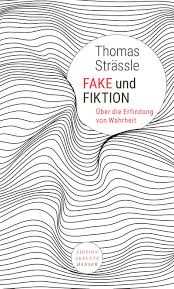
Thomas Strässle: «Fake und Fiktion. Über die Erfindung von Wahrheit»
Hanser, 96 Seiten